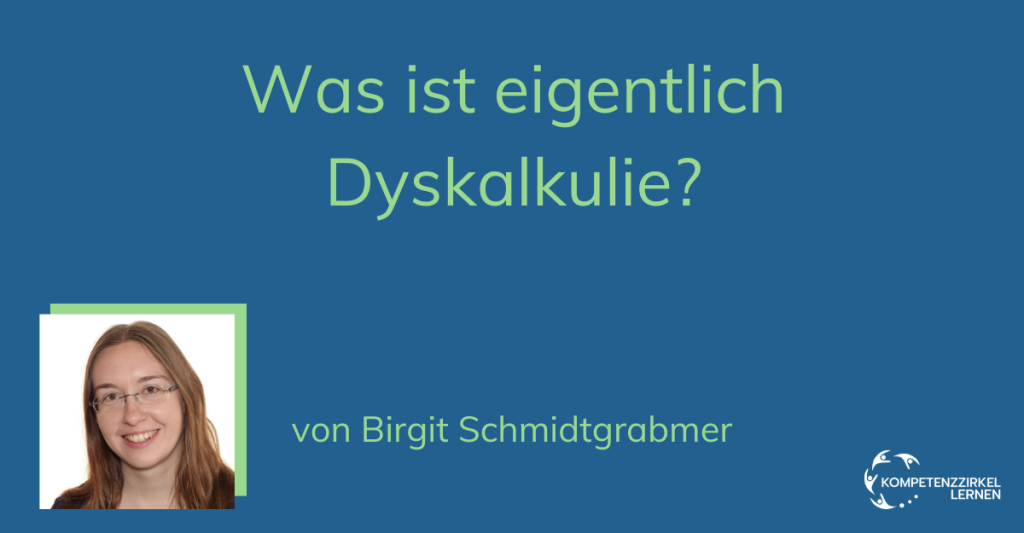Dyskalkulie ist eine Rechenstörung, ca. 3-6% der deutschsprachigen Menschen sind davon betroffen. Das bedeutet, dass in jeder Schulklasse 1-2 Kinder mit Dyskalkulie sitzen. Allerdings sind viele davon nicht getestet oder ihre Dyskalkulie wird nicht oder erst sehr spät erkannt. Eine Dyskalkulie ist dann vorhanden, wenn ein Kind beim Rechnen im Vergleich zu Gleichaltrigen in den untersten 10% liegt, es also bei der Diagnostik einen Prozentrang von 1-10 erreicht.
Dyskalkulie ist nicht gleich Dyskalkulie. Diese ist bei jeder Person anders ausgeprägt, deshalb hat auch jede*r andere Schwierigkeiten und Herausforderungen beim Rechnen.
Merkmale einer Dyskalkulie
Menschen mit Dyskalkulie verrechnen sich oft. Bei Kindern kann man sehen, dass sie sich oft um eins verzählen, ihr Ergebnis ist dann um eins zu viel oder zu wenig. Sie raten auch oft die Ergebnisse, wenn ihnen eine Rechnung zu schwierig erscheint. Auch das Rechnen mit den Fingern und das zählende Rechnen sind Merkmale einer Dyskalkulie.
Dyskalkulie betrifft das Zahlen- und Mengenverständnis. Diese fallen dann sehr schwer. Die Kinder können sich Zahlen und Mengen nicht oder nur sehr schwer vorstellen, für sie ist es schwer vorstellbar, ob 23 oder 68 mehr sind und wie viel das ist. Sind es große oder kleine Zahlen? Was bedeutet eine Zahl eigentlich? Das sind Schwierigkeiten von Kindern mit Dyskalkulie.
Der Zehnerübergang fällt vielen Kindern mit Dyskalkulie sehr schwer. Sie lernen im Zahlenraum 10 zu rechnen, das ist schwierig, aber sie schaffen es, denn dafür können sie ihre Finger nutzen. Sobald es aber über den Zehner geht, ist das für viele wirklich schwierig. Sie brauchen viel anschauliches Material und viel spielerische Förderung, um den Zehnerübergang verstehen zu können.
Ursachen einer Dyskalkulie
Die genauen Ursachen einer Dyskalkulie sind noch nicht restlos erforscht und wir verstehen sie noch nicht so genau. Es gibt aber einige Faktoren, die eine Dyskalkulie begünstigen können:
- Neurobiologische Grundlagen: Dysfunktion im Gehirn, Zahlen werden anders verarbeitet
- Genetische Faktoren: Dyskalkulie ist teilweise vererbt. In manchen Familien haben mehrere Familienmitglieder Dyskalkulie.
- Umweltfaktoren: Unterricht, Förderung, Anregung zuhause
Wie kann ich meinem Kind helfen?
Ein Dyskalkulietraining ist sehr effektiv, weil es am aktuellen Niveau des Kindes ansetzt und das Kind somit dort abholt, wo es gerade steht. Das Kind lernt im Dyskalkulietraining die Zahlen noch einmal von vorne, es werden die Grundrechnungsarten geübt und alles spielerisch und anschaulich erarbeitet und zwar so lange, bis das Kind es verstanden hat. Daher kann es auch sein, dass ein gewisser mathematischer Bereich einige Wochen lang bearbeitet wird – immer wieder auf verschiedene Arten und mit verschiedenen Übungsideen.
Auch zuhause sollten Kinder mit Dyskalkulie jeden Tag ein bisschen üben. Je nach Alter des Kindes werden 10 Rechnungen oder 10 Minuten üben pro Tag empfohlen. Die Aufgaben sollen das Kind nicht überfordern.
Sehr wichtig ist es, dass Eltern Verständnis für die mathematischen Probleme ihres Kindes zeigen. Das Kind sollte bestärkt werden und das Selbstbewusstsein des Kindes sollte wieder aufgebaut werden. Kinder mit Dyskalkulie erfahren oft viel Ungerechtigkeit und Unverständnis, weil sie von anderen zu Unrecht als dumm oder faul abgestempelt werden und das sind sie nicht. Im Gegenteil, Kinder mit Dyskalkulie üben meist viel mehr als ihre Klassenkolleg*innen, aber sie brauchen mehr Übung und mehr Wiederholungen, bis sie einen Rechenweg verstehen. Deshalb ist es wichtig, dass die Eltern an das Kind glauben und es immer wieder bestärken, dass es die Aufgaben schaffen kann und dass der Wert des Kindes nicht von den Noten abhängt.
Kinder mit Dyskalkulie sollten nicht mit anderen Kindern verglichen werden, weder mit den Geschwistern, noch mit Mitschüler*innen, denn sie lernen einfach anders, ihr Gehirn verarbeitet Zahlen anders und deshalb ist es nicht vergleichbar. Abgesehen davon sollte man Kinder sowieso nicht miteinander vergleichen, denn jeder Mensch ist anders.
Spielerisch üben macht mehr Spaß. Man kann das Rechnenüben auch gut in den Alltag integrieren. Ihr wollt ein Zimmer streichen? Lass dein Kind ausmessen und berechnen, wie viel Farbe ihr braucht. Ihr backt Kekse oder einen Kuchen? Dein Kind darf mithelfen und die Zutaten abwiegen. Ihr seid um 15:00 eingeladen. Lass dein Kind berechnen, wann ihr zuhause weggehen müsst. Solche Situationen kennst Du sicher viele. Lass dein Kind mitmachen und sei geduldig, wenn es vielleicht ein bisschen länger dauert, bis etwas berechnet ist, als wenn Du es selbst machen würdest.
Es gibt auch Apps und Lernspiele für Mathematik, die die Kinder motivieren und ihnen so dabei helfen, das Rechnen leichter zu verstehen. Oft haben die Spiele ein Zeitlimit, dann wandelt das Spiel so ab, dass dein Kind genug Zeit zum Rechnen hat. Es muss nicht immer um die Schnelligkeit gehen.
Weiters ist es hilfreich, den Stress möglichst zu reduzieren. Kinder mit Dyskalkulie empfinden oft sehr viel Stress, wenn sie rechnen müssen, denn sie wissen, dass es ihnen schwer fällt. Deshalb ist es sinnvoll, zuhause den Stress rauszunehmen. Lass deinem Kind Zeit fürs Rechnen und übt möglichst spielerisch, damit es nicht so langweilig und anstrengend für dein Kind ist. Im Spiel können Kinder viel lernen.
Eine Elterngruppe ist eine gute Möglichkeit, um sich mit anderen Eltern zu vernetzen und auszutauschen. Eltern von Kindern mit Dyskalkulie sind oft recht einsam, weil nur wenige Kinder eine diagnostizierte Dyskalkulie haben, daher gibt es nicht so viele Kinder und viele Familien sind Einzelkämpfer. In einer Elterngruppe können sich die Eltern gegenseitig beraten und ihre Erfahrungen austauschen. Gemeinsam schafft man manche Situationen leichter als alleine.
Wenn deine Familie sehr belastet ist durch die Dyskalkulie oder wenn es wegen der M-Hausaufgaben ständig Streit gibt, dann sucht euch professionelle Hilfe. Eine psychologische Beratung, eine Familientherapie, ein Coaching oder Elternberatung können euch weiterhelfen.
Diagnostik
Wenn dein Kind Schwierigkeiten in Mathematik hat und Du bemerkst, dass es sich generell schwer tut, dass es Probleme mit dem Kopfrechnen hat, dass es sehr lange mit den Fingern rechnet oder wenn die mangelndes Mengenverständnis auffällt, dann lass es testen.
Bei einer Dyskalkulie-Diagnostik werden mit deinem Kind ein Rechentest und ein Intelligenztest gemacht. Der Intelligenztest ist spielerisch aufgebaut und macht den meisten Kindern Spaß. Ein Intelligenztest ist notwendig, um beurteilen zu können, ob ein Kind normal begabt oder hochbegabt ist. Denn nur dann kann eine Dyskalkulie diagnostiziert werden. Kinder mit Dyskalkulie sind also auf jeden Fall schlau, denn sie müssen normal oder überdurchschnittlich begabt sein.
Wenn Du eine Diagnostikstelle suchst, achte darauf, dass sich die Fachpersonen dort mit Dyskalkulie auskennen, dass sie auf Kinder spezialisiert sind und dass die Testleitung dir und deinem Kind sympathisch ist. Wenn sich ein Kind bei der Testung nicht wohl fühlt, kann das die Ergebnisse beeinflussen.
Oft gibt es lange Wartezeiten auf einen Diagnostiktermin, deshalb lass dein Kind auf die Warteliste schreiben, auch wenn Du noch unsicher bist, ob ihr die Testung wirklich braucht. Einen Termin kann man auch jederzeit wieder absagen und dann freut sich jemand anderer, wenn er oder sie einen früheren Termin bekommt.
Hilfe in der Schule
In den Schulen kommt Dyskalkulie nach und nach an, aber viele Schulen sind noch immer nicht wirklich gut informiert, wenn es um Dyskalkulie geht.
In manchen Bundesländern in Deutschland gibt es einen Nachteilsausgleich bei Dyskalkulie, in anderen leider nicht.
In Österreich gibt es einen Nachteilsausgleich, aber es gibt keine Regelungen dazu und die Lehrkräfte werden damit allein gelassen, sich zu überlegen, wie sie die Kinder mit Dyskalkulie unterstützen können.
Viele Lehrkräfte bemühen sich sehr, die Kinder zu fördern und ihnen die Schularbeits- und Testsituationen zu vereinfachen, aber viele Kinder werden bis heute nicht verstanden und bekommen kaum Hilfe in der Schule.
Ich finde es wichtig, dass sich das ändert und dass Dyskalkulie bekannter gemacht wird!